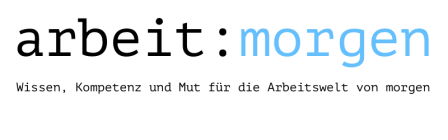Ein Dialog über Unternehmensdemokratie mit Andreas Zeuch
Nach einer kontroversen Diskussion auf Twitter über Sinn und Zweck von Unternehmensdemokratie und der Lektüre meines Beitrages #SorgenvonMorgen 2 machte mir Dr. Andreas Zeuch, Autor des Buches “Alle Macht für niemand – Aufbruch der Unternehmensdemokraten“, den Vorschlag, statt eines Gastbeitrags an dieser Stelle einen Dialog zwischen uns über das Thema zu veröffentlichen. Diese Idee gefiel mir so gut, dass ich sofort zugesagt und auch gleich einen ganzen Packen Sorgen für Andreas gesammelt habe, den ich ihm nun dialogisch vor die Füße werfen kann.
Andreas Schiel: Toll, dass Du Dich so spontan zu einem Gedankenaustausch auf meinem Blog bereit gefunden hast – und das so persönlich, von Andreas zu Andreas! Du hast ja schon gelesen, dass ich von dem Indianer-Einwand (“Es darf nicht nur Häuptlinge geben!”) gegen Unternehmensdemokratie gelinde gesagt nicht besonders viel halte. Aber ein anderes Bild finde ich gar nicht so unpassend: Sind in einem demokratisch, soziokratisch oder sonstwie partizipativ organisierten Unternehmen nicht tatsächlich manchmal zu viele Köche am Werk, die den Brei verderben, sprich mittelmäßige bis dürftige Kompromisse produzieren?
Andreas Zeuch: Auf den ersten Blick erscheint die Analogie ja irgendwie treffender zu sein. Allerdings ist sie nur bedingt sachlich zutreffend. Ja, viele Köche können den Brei verderben, natürlich. Das dem grundsätzlich nicht so sei, ist eine genauso absurde Behauptung, wie das Gegenteil. Das liegt ganz einfach an der Frage, ob das – wie ich es nennen – operative EntscheidungsDesign für die Aufgaben des jeweiligen sozialen Systems (gesamte Organisation, ein Bereich, eine Abteilung, ein Team etc.) angemessen entwickelt ist. Wie genau werden die Entscheidungen in den (Groß)Gruppen getroffen? Einfach indem jeder seine Meinung, Ideen oder was auch immer ungefiltert in den Kommunikationsraum hinausposaunt? Oder werden statt dessen professionelle Kommunikations- und Entscheidungsmethoden genutzt? Abschließend möchte ich daran erinnern, dass die Redewendung aus einem hochgradig hierarchischen und spezialisierten Bereich stammt. Es gibt ja nicht nur den Küchenchef und seinen Stellvertreter, sondern zum Teil auch irgendwie ulkig wirkende Spezialisten wie einen Nacht- (Chef de Nuit) oder Eierkoch (Cocottier). Klar, dass da nicht jeder seinen Senf dazugeben durfte.

Andreas Zeuch und sein aktuelles Buch. Texte von ihm und anderen Unternehmensdemokraten kann man auch auf seinem Blog lesen.
Schiel: Na gut, Punktsieg für Dich. Dass es letztlich immer auf das Wie ankommt, sehe ich ein. Habe auch schon mal davon gehört, dass Entscheidungen auf gute und schlechte Weise gefällt werden können, egal wie viele Menschen dabei mitwirken. Ich glaube, was ich mit den Köchen andeuten wollte, war ein grundsätzliches Problem: Wenn Du von Demokratie sprichst, dann rufst Du bei Deinen Zuhörern ganz bestimmte Bilder auf, die von vielen damit in Verbindung gebracht werden. Du kennst sicher die Ansicht, dass die Demokratie zumeist nur schlechte und zudem mühsam erarbeitete Kompromisse hervorbringe. Dass sie ein ungeordnetes Feilschen, eine unbefriedigende Rechthaberei sei, bei der am Ende wenn nicht alle, dann doch viele weit gehend leer ausgehen. Auf diese Ansichten bin jedenfalls ich bei meinem Engagement für eine Weiterentwicklung und Vertiefung der Demokratie immer wieder gestoßen. Es gibt sogar Fatalisten, die reden nur noch von Postdemokratie, wenn sie westliche Gesellschaften betrachten. Und in der Tat weist ja die repräsentative Demokratie, so wie sie ist, manches Defizit auf und ist wirklich nicht dafür bekannt, besonders schnelle oder außerordentlich kluge Entscheidungen zu treffen. Wenn Du also den Demokratiebegriff nun in den Nexus der Privatwirtschaft überträgst, dann hängt da also eine ganze Menge dran – und das ist nicht nur positiv. Da überrascht es mich nicht, wenn viele das hören und sagen: Bloß das nicht, nicht auch noch bei uns! Welches Bild von Demokratie stellst Du denn dagegen – denn Du wirst doch mit Unternehmensdemokratie sicher nicht meinen, dass man über jede Kleinigkeit jahrelang verhandelt und dann nur zu faulen Kompromissen findet?
Zeuch: Du sprichst da etwas Zentrales an. Ich bin mir nicht sicher, ob ich nicht noch radikaler und fundamentaler real-demokratische Staatsverfassungen hinterfrage, als die Kritiker der Unternehmensdemokratie. Ich tue niemandem den Gefallen, so naiv zu sein, unsere gesellschaftspolitischen Demokratien für das Nonplusultra zu halten. Aber grundsätzlich wäre auch in dieser Sphäre mal festzuhalten: Demokratische Gesellschaften sind deutlich robuster als zentralistisch und autokratisch geführte Staaten. Das nur am Rande.
Natürlich geht es nicht darum, jeden Entscheidungstropfen zu einem Sturm im Wasserglas aufzublasen. Das Gegenteil ist der Fall. Denn die Idee demokratischer Organisationen besteht ja unter anderem darin, ein hochfunktionales, modernes EntscheidungsDesign zu entwickeln. So können zum Beispiel Einwände gegen Vorschläge, neue Ideen etc. nur dann akzeptiert werden, wenn sie begründet zeigen, dass die Entscheidung für die diskutierte Option zu schwerwiegenden Problemen in der Organisation führt. Das wiederum ist eine MÖGLICHE Lösung für die Entscheidungslähmung, die Du ansprichst. Dieses Vorgehen führt dann dazu, Vorschläge, Ideen usw. iterativ experimentierend an der WIRKLICHKEIT zu testen, statt theoretisch langwierig darüber zu debattieren. In unseren Gesellschaften verhandeln wir allerdings auch oft wesentlich weitreichendere Konsequenzen als wir dies bei organisationalen Entscheidungen finden. Ein Beispiel sei nur das Thema Sterbehilfe.
Abgesehen davon stellt sich eine wichtige Frage: Ist das altbekannte Top-Down tatsächlich besser? Aktuell zeigt sich das Totalversagen dieses Ansatzes in der Energieindustrie: Die großen, natürlich mehr oder minder altbekannt geführten Konzerne E.on, RWE, EnBW und Vattenfall dürfen sich jetzt mir der Zahlung von insgesamt rund 23 Milliarden Euro aus der Verantwortung stehlen und damit das restlich verbleibende Risiko der Endlagerung und des Rückbaus der Atomkraftwerke an die Gesellschaft delegieren. Wäre dieser Schritt nicht erfolgt, hätte den Konzernen die Insolvenz gedroht – weil sie sich nicht schnell genug an die veränderten Markt- und Umfeldbedingungen angepasst haben. Wäre das nicht so ärgerlich, wäre es ein echter Lacher. Das zur angeblich schnelleren, effizienteren und kompetenteren EntscheidungsKultur des Top-Down.
Schiel: Okay, ich verstehe, glaube ich, die grundsätzliche Zielrichtung Deiner Argumentation: Demokratie ist – ob in der Politik oder in der Wirtschaft – zumindest vom Grundsatz her die modernere, flexiblere, resilientere Organisationsweise, was natürlich durch eine mangelhafte Ausführung in der Praxis hie und da nicht prinzipiell widerlegt wird. Kann man so sehen, glaube ich eigentlich auch. Aber erstens habe ich Dein Argument gegen Top-Down an Hand der nuklearen Altlasten nicht ganz verstanden: Wäre hier etwas anders, wenn die Energiekonzerne demokratisch organisiert wären? Pleite gehen könnten sie trotzdem. Aufs falsche Pferd setzen auch, oder nicht? Und zweitens bleibt für mich weiter die Frage: Warum eigentlch Unternehmensdemokratie als Begriff? Lässt sicher erstmal aufhorchen, aber zieht eben auch viele Klischees und Vorurteile an, die andere Begriffe wie Selbstorganisation, mitarbeitergeführte Unternehmen, Augenhöhe oder geteilte Verantwortung nicht so schnell aufrufen dürften.
Zeuch: Mir ging es mit dem Beispiel des Managementversagens der Energiekonzerne darum, dass das Top-Down eben auch kein Garant für Erfolg ist. Es wird ja immer wieder sinnloserweise argumentiert, dass Unternehmensdemokratie kein Erfolgsgarant wäre – natürlich nicht. Nichts kann Erfolg garantieren.
Zur Begriffswahl: Die Widersprüche und Reibungspunkte sind intendiert. Mit Selbstorganisation habe ich mich schon Anfang der 1990er intensiv befasst. Der Begriff hat immer noch seine Berechtigung, lockt aber niemand mehr hinter dem Ofen hervor. Mitarbeitergeführte Unternehmen erinnert mich vor allem an eine Unternehmensgruppe, denen ich das schlicht nicht mehr glaube. Augenhöhe ist eine schöne Metapher, aber eben kein begriffliches Konzept. Unternehmensdemokratie hingegen polarisiert, weckt auf und bringt Menschen schnell in Diskussionen.
Last not least geht es mir ja gerade auch um die Idee, Arbeit neu als Demokratielabor zu interpretieren, so wie ich das im dritten Kapitel des Buches dargelegt habe. Immerhin werden die positiven Auswirkungen demokratischer Organisationen auf das Verhalten der Mitarbeiter in deren Freizeit schon seit den 1980ern empirisch untersucht. Es sieht ganz danach aus, als ob es einen Spill-Over Effekt aus der demokratischen Arbeitskultur in die Gesellschaft hinein gäbe.
Schiel: Ich versuche es mal mit einer letzten Frage, bzw. Überlegung. Faszinierend an Deinem Ansatz finde ich gerade den zuletzt von Dir berührten Punkt: Die Wechselwirkungen zwischen der Arbeitswelt und dem Rest der Gesellschaft. Ich frage mich nämlich auch schon seit Langem, wie Demokratie im politischen System langfristig erfolgreich sein soll, wenn sie in zwei anderen sozialen Systemen, nämlich dem der Wirtschaft und der Schule so stiefmütterlich behandelt wird. Wie sollen wir denn zu guten und überzeugten Demokraten werden, wenn wir weder von der Lehrerin noch vom Chef nach unserer Meinung gefragt werden – jedenfalls dann nicht, wenn es wirklich um etwas geht? Da finde ich Deinen Ansatz genial, hier auf eine demokratische Belebung der Arbeitswelt zu zielen. Mein Kritikpunkt würde aber vielleicht darin liegen, dass Du mit dem Demokratie-Begriff hier schon recht viel vorweg nimmst. Noch ist ja die Demokratie in Unternehmen bis auf wenige Ausnahmen nicht so weit entwickelt wie die im politischen System. Und vielleicht wird und muss sie ganz andere Formen aufweisen, ganz andere Verfahren bemühen, als das im politischen System der Fall ist. Wäre es da nicht doch sinnvoll, zumindest langfristig auf einen Begriff hinzuarbeiten, der Partizipation und geteilte Verantwortung im Organisationskontext ausdrückt, ohne sich zu sehr an die ‘große Schwester’ Demokratie anzulehnen?
Zeuch: Danke für dieses große Kompliment, allerdings hatten andere schon lange vor mir die Idee, auch wenn ich das erst hinterher herausgefunden habe.
Der Begriff der Unternehmensdemokratie ist ja, wie es in meinem Buch gezeigt habe, sehr vielschichtig. Es gibt nicht die eine richtige Form der Unternehmensdemokratie. Die demokratische Verfassung von Organisationen ist vielmehr ein fortlaufendes Kontinuum, von autokratisch bis hin zu einer starken demokratischen Struktur und Kultur. Abgesehen davon reden wir aus meiner Sicht ohnehin automatisch über eine Begriffswolke. Unternehmensdemokratie umfasst doch Begriffe wie Partizipation und geteilte Verantwortung und ist verwandt mit anderen Begriffen wie Neue Arbeit, Arbeiten 4.0, agile Unternehmensführung und so weiter.
Abschließend würde ich einfach feststellen: es gibt da kein richtig oder falsch. Wer welchen Begriff nutzt ist jedem selbst überlassen. Für mich steht der gesellschaftspolitische Impact ebenso im Vordergrund wie der bereits erwähnte Effekt, dass dieser Begriff am ehesten Diskussionen und Auseinandersetzungen mit den ökonomischen, sozialen, psychologischen und ethischen Dimensionen der Führung von Organisationen hervorruft.
Außerdem halte ich es mit Wittgenstein: Die Bedeutung eines Begriffs entsteht mit dessen Gebrauch.
Schiel: Andreas, ich danke Dir ganz herzlich für dieses Gespräch! Ich jedenfalls habe einiges dazugelernt – und es ist ein bisschen so gekommen wie ich gehofft hatte: Wie in einem der Dialoge von Platon, die ich im Studium immer sehr gern gelesen habe, ist es uns immerhin gelungen zu verstehen, warum meine erste Intuition, die mit den Köchen, eigentlich eine unzureichende, um nicht zu sagen falsche Vorstellung von Unternehmensdemokratie war. Und in unserem Gespräch haben wir uns sicher ein gutes Stück der Wahrheit genähert – trotzdem gibt es noch einiges zu bedenken, aufzuklären und zu diskutieren. Für gute Demokraten eigentlich ein ziemlich schönes Ergebnis – oder nicht?!
Zeuch: Danke, Andreas, das geht mir ebenso. Unser Gespräch reflektiert meiner Meinung nach gut das, was Demokratie positiv ausmacht: gemeinsam denken bereichert das Ergebnis!