Lernen von Erich Fromm: Warum die Angst ein steter Begleiter von Ungewissheit und Komplexität ist – und warum es Liebe und Solidarität braucht, wenn man dieser Angst begegnen will.

Oh my goodness! Der moderne Mensch lässt sich und seinesgleichen mit der Überforderung durch Komplexität weitgehend allein. Warum eigentlich?
Oh my goodness! – Hätte meine Englischlehrerin gesagt und wird sie wahrscheinlich auch gesagt haben, als eine Woche vor Erscheinen dieses Artikels deutlich wurde, was den netten Leuten auf der anderen Seite des Ärmelkanals gerade für ein gewaltiges Missgeschick passiert war: Sie hatten den Austritt ihres Landes aus der Europäischen Union (besser bekannt als ‚die EU‘) beschlossen. Hochoffiziell, per Volksabstimmung. Oh my goodness!
Mein Mit-Düsseldorfer, Fast-Nachbar und bevorzugter Komplexitäts-Experte Mark Lambertz hat dankenswerter Weise schon am Tag nach dem Bekanntwerden der Entscheidung die Aufgabe übernommen, das allgemeine Erstaunen und Entsetzen über diesen eigenwilligen Zug britischer Extravaganz etwas zu versachlichen und auf den Punkt zu bringen:
Es fällt schwer, sich der analytischen Schärfe dieser Beobachtung zu entziehen: Ist nicht genau das der Grund für das Abstimmungsergebnis? Die Weigerung oder vielleicht auch das Unvermögen einer Mehrheit derer, die da abgestimmt haben, sich mit der Komplexität der sie umgebenden Wirklichkeit ernsthaft zu befassen? Gut, vielleicht wäre ihnen das mit Hilfe eines anderen Entscheidungs-Designs leichter gefallen. Jedenfalls ist die konsequente Digitalisierung von Allem und Jedem allein offensichtlich noch kein ausreichender Ansatz, um dem Problem Komplexität zu begegnen. Denn was ist die Durchführung einer zweiwertigen Ja-Nein-Abstimmung über ein unglaublich verworrenes und vieldeutiges Thema wie die Mitgliedschaft in der Europäischen Union sonst, wenn nicht der ungeschickte Versuch einer Digitalisierung der Politik?
Aber das Nachdenken über Entscheidungs-Designs, so wichtig es auch sein mag, um etwa zeitnah anderen Ländern ähnliche Missgeschicke zu ersparen, führt uns, glaube ich, noch nicht zum Kern des Problems. Der ist dagegen in Marks Tweet zumindest zur Hälfte schon sehr gut erfasst („complexity deniers“). Um freilich das „FTW“ aufzulösen, werden wir weit mehr als 140 Zeichen benötigen. Dabei hilft uns dieses Mal der Soziologe, Psychiater und Philosoph Erich Fromm, mit den immerhin 254 Seiten seines sechzig Jahre alten Buches „Wege aus einer kranken Gesellschaft“. Aus der Beschäftigung mit diesem Buch nämlich, können wir lernen, warum Menschen sich ständig neue Wege ausdenken, um der Komplexität aus dem Weg zu gehen – und wie wir unsere Gesellschaft und unsere Organisationen verändern müssen, damit das endlich aufhört.
Angst vor der Freiheit
Dafür aber, müssen wir irgendwo anfangen. Kein schlechter Beginn ist hier die Einsicht in ein bestehendes Problem, denn die ist bekanntlich nicht selten der erste Schritt zu dessen Lösung. Erich Fromms Bücher sind voller solcher Einsichten, und eine (von S. 139) habe auch ich gleich bei Twitter geteilt, weil sie mir so gut gefällt:
Eigentlich ist es ja nämlich ganz einfach: Unsicherheit und Ungewissheit sind die Kennzeichen modernen Lebens. Wer sich nicht konstant von anderen herumkommandieren lassen möchte und nicht akzeptieren will, dass sein Leben von der Wiege bis zur Bahre vorgeplant und durchreguliert wird, kommt ohne Risiken (des Irrens, des Scheiterns, ja des Schadens an Leib und Leben) nicht aus. Und da wir in einer Zeit leben, die eine solche Entscheidung für Freiheit und Selbstbestimmung immer mehr Menschen ermöglicht, ja sie zum Teil sogar von ihnen erwartet, bleibt es nicht aus, dass sich heutztutage viele in einem Zustand mehr oder weniger großer Unsicherheit und Ungewissheit wiederfinden – sei dieser privat oder beruflich, sei er ökonomischer oder emotionaler Natur. Mit Unsicherheit müssen Menschen, müssen Organisationen und müssen Gesellschaften leben.
Nur machen sie aber dabei derzeit keine besonders gute Figur. Da kann man natürlich anfangen, mit dem Finger auf diejenigen zu zeigen, die gerade am schlechtesten aussehen, weil sie sich nach einer Phase akuter Unsicherheitspanik und Uneindeutigkeitsverleugnung in einem nunmehr wirklich unüberschaubaren Komplexitäts-Plumpudding namens ‚Brexit‘ wiederfinden. Man kann sich allerdings auch daran erinnern, wann man sich selbst das letzte Mal mit einer übergroßen Portion Unsicherheit und Ungewissheit konfrontiert gesehen hat, und was einem damals geholfen hat, da heil wieder herauszufinden.

Sich in der Komplexität zurechtzufinden ist nämlich nicht nur ein intellektuelles Kunststück, wie es manche anspruchsvollen Abhandlungen dazu, manche Beratungskonzepte und auch viele (wie ich finde etwas überhebliche) Reaktionen auf den sogenannten Brexit nahelegen. Es ist vielmehr eine existenzielle Lebensaufgabe, die jeden einzelnen Menschen betrifft und in allen Facetten seines Seins herausfordert. Alles aber, was uns existenziell berührt, verursacht auch Emotionen. Meistens sind das sogar sehr heftige Emotionen, die sich da Bahn brechen.
Und im Zusammenhang mit Ungewissheit und Komplexität ist das vor allem ein Gefühl: Angst. Mit dem Titel seines wahrscheinlich bekanntesten Buches hat Erich Fromm dafür eine treffende Formulierung gefunden: Die Furcht vor der Freiheit. Aber was ist das für eine Furcht und woher kommt sie? In seinem Nachfolgebuch, das uns hier beschäftigt, sucht Fromm nach Auswegen aus dieser Furcht – und beschreibt ihre Ursachen:
Wir stehen nicht mehr im Mittelpunkt des Universums, wir sind nicht mehr Zweck der Schöpfung, wir sind nicht mehr die Herren einer beherrschbaren und erkennbaren Welt – wir sind ein Staubkörnchen, ein Nichts irgendwo im Raum ohne eine konkrete Beziehung irgendwelcher Art zu irgend etwas. […] Die Dimensionen, mit denen wir es zu tun haben, sind Zahlen und Abstraktionen; sie gehen weit über die Grenzen hinaus, die wir noch konkret erleben können. […] Während unsere Augen und Ohren nur Eindrücke aufnehmen, die den von uns beherrschbaren Proportionen entsprechen, hat unser Weltbild eben diese Qualität verloren; es entspricht nicht mehr unseren menschlichen Dimensionen. (S. 87)
Könnte man eine bessere Beschreibung für das Empfinden des ‚Durchschnittseuropäers‘ finden, wenn er seine Alltagserfahrung mit dem abzugleichen versucht, was ihn an Nachrichten und offiziellen Verlautbarungen aus ganz Europa erreicht? Stellen Sie sich mal auf einen Hügel in Cornwall, Ostwestfalen oder Apulien und versuchen Sie von dort aus, die Interdependenzen des europäischen Wirtschafts- und Finanzsystems zu überblicken oder die Zusammenhänge der Migrationspolitik oder der Agraförderung. Und lassen Sie sich bloß nicht von der idyllischen Landschaft und den netten, ganz normalen Leuten um sie herum dazu verführen, nach einfacheren, menschengemäßen Bildern dieser Wirklichkeit zu suchen. Die werden zwar besser aussehen und in den jeweiligen lokalen Rahmen passen – aber Obacht! – unweigerlich dramatisch unterkomplex ausfallen.
Nein, kommen Sie doch jetzt bitte aus Ihrer Komfortzone heraus und begeben Sie sich einmal in den driver seat! Haben Sie doch den Mut, vom Getriebenen der Komplexität zu Ihrem Manager zu werden! Ach so, Manager haben es auch nicht leicht, Herr Fromm?
…genau wie jeder andere hat es auch der Manager mit unpersönlichen Giganten zu tun: mit riesigen Konkurrenzunternehmen, mit dem riesigen Binnen- und Weltmarkt, mit der Riesenverbraucherschaft, die es zu überreden und zu manipulieren gilt, mit Riesengewerkschaften und mit einer gigantischen öffentlichen Verwaltung. Alle diese Giganten haben sozusagen ihr eigenes Leben. Sie bestimmen sowohl die Tätigkeit des Managers als auch die der Arbeiter und Angestellten. (S. 91)
Hm. Giganten, die über unser Leben bestimmen, deren Ausmaße wir nicht überblicken können. Ein Schelm, wer da an Brüssel und die EU denkt. VW reicht schon. Verstehen Sie, worauf ich hinaus will? Die ganze Unübersichtlichkeit und Unüberschaubarkeit der Welt ist mehr als ein Ärgernis, für dessen Bewältigung man nur besonders clevere Berater anstellen müsste. Es ist erstens eine Kränkung, die uns stetig daran erinnert, dass wir die Welt, in der wir leben, als Individuen nur vollkommen unzureichend verstehen und überblicken können. Das allein aber wäre für die meisten von uns wohl noch zu verschmerzen. Es ist aber noch mehr: Es handelt sich um die stete Bedrohung durch ungewisse und womöglich immense Risiken, die millionenmal größer sind als wir – und denen wir wie hilflose Zwerge gegenüberstehen: Flüchtlingsströme, Finanzkrisen, Kreditklemmen, Klimakatastrophen, feindliche Übernahmen, Massenentlassungen undundund.
Der moderne Individualismus braucht Solidarität
Vielleicht aber wäre das alles nicht so furchterregend, wenn wir in der Moderne nicht dieses etwas eigenwillige Konzept namens Individualismus entwickelt hätten, was besagt, dass letztlich jeder allein für seine Entscheidungen und auch für seine Fehler einzustehen hat. Woraus wir dann wiederum unsere Führungs- und Verantwortungskultur abgeleitet haben, die immer noch fast überall einzelne Menschen für das verantwortlich macht, was nicht einmal ein Raum voller ExpertInnen überblicken könnte. Und je anspruchsvoller wir in unseren Erwartungen an die Leistungsfähigkeit menschlicher Organisationen werden, desto mehr Verantwortung wird auch dem einzelnen übertragen. Da kann sich dann auch ein Sachbearbeiter am Ende der Hierarchie noch mit Anforderungen konfrontiert sehen, die seine Fähigkeit, das Ganze zu überschauen um ein vielfaches übersteigen.
Nichts gegen die Bereitschaft, Verantwortung für das eigene Tun zu übernehmen. Man findet sie viel zu selten. Aber das hat Gründe: Irgendwie muss der tiefe Fall derjenigen abgefangen werden, die sich vertun und verschätzen. Und zwar am Besten schon bevor sie fatale Irrtümer begehen – und nicht erst, wenn deren Zeugen nur noch die Wahl zwischen Schadenfreude und Bedauern bleibt. Poetisch gesprochen: Einer der springt braucht auch jemanden, der ihn auffängt. Erich Fromm ermahnt uns deshalb, einen Wert wieder schätzenzulernen, der in unserem öffentlichen Leben und in unserer professionellen Welt fast schon in Vergessenheit geraten ist: Liebe.

Für alle, die jetzt einen Schreck kriegen: Man kann auch andere Begriffe für das verwenden, worum es hier geht. Solidarität ist einer davon. Erich Fromm aber spricht von Liebe, um die Universalität, die enorme Bedeutung und Durchschlagskraft eines solchen Wertewandels zu beschreiben, wie er ihn anstrebt. Wozu aber brauchen wir Liebe, Solidarität oder etwas derartiges? Ganz einfach, sagt Fromm: Weil uns überall dort, wo sie fehlt, das Leben extrem schwer gemacht wird. Noch nämlich finden wir eine Kultur vor, die nicht nur weit gehend verständnislos mit dem Fehler, dem Irrtum, dem Scheitern umgeht – die vielen Appelle an eine neue ‚Fehlerkultur‘ lassen grüßen -, sondern Organisationen und eine ganze Gesellschaft, die allzuschnell geneigt sind, den Gescheiterten auszugrenzen und zu stigmatisieren. In der Euro-Krise (diesmal der mit dem Geld) war zwar viel die Rede von Solidarität, aber ihr Ergebnis war die Ausgrenzung und Demütigung Griechenlands als eine unmögliche Nation unzuverlässiger Schuldner. Unsere Schulen halten zwar selbst noch für die ‚leistungsschwächsten‘ Schüler ‚individuelle Förderpläne‘ bereit, aber sie stehen doch schnell in der Gefahr, als ‚Minderleister‘ oder sogar ‚Schulversager‘ an den Rand gedrängt zu werden.
Und in der Arbeitswelt? Wird immer noch nach ‚Low-Performern‘ gesucht, und immer noch gibt es Geschäfts- und Erfolgsmodelle, die darauf bauen, diese aus dem Unternehmen zu drängen. À propos Arbeitswelt: Kaum ein anderer Ort scheint derart gekennzeichnet von der frappierenden Abwesenheit von Liebe und Solidarität. Was zunächst an einem trivialen Grund liegt:
Dass ich einem anderen helfe, geschieht, weil ich mich als menschliches Wesen aktiv um seine Liebe, Freundschaft und Sympathie bemühe. Das ist in der Beziehung zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer nicht der Fall. Der Arbeitgeber hat sich die Dienstleistungen des Arbeiters gekauft, und er mag ihn noch so menschlich behandeln, er wird ihm immer Befehle erteilen, und zwar nicht auf der Grundlage von Gegenseitigkeit, sondern weil er sich seine Arbeitszeit so und so viele Stunden täglich gekauft hat. (S. 70)
Im Arbeitsleben, so Fromm, finden wir oft noch eine instrumentelle Haltung gegenüber dem Mitmenschen vor: Dann kooperieren zwei nicht etwa, weil einer dem anderen etwas Gutes tun will. Nein, sie benutzen einander, so wie man einen Hammer benutzt, um einen Nagel in die Wand zu schlagen. Aber nicht aus Bosheit, sondern aus Gewohnheit:
Dieses Benutzen hat grundsätzlich nichts damit zu tun, ob die Menschen auf grausame oder auf nicht grausame Weise behandelt werden, sondern es geht um die fundamentale Tatsache, dass ein Mensch einem anderen zu Zwecken dient, die nicht seine eigenen, sondern die seines Arbeitgebers sind. (S. 69)
Natürlich hat Fromm, wie aus dem Zitat hervorgeht, hierbei weniger die freiwillige Kooperation zweier Selbstständiger im Blick, als die mehr oder weniger unfreiwillige Tätigkeit eines Angestellten. Nur: Überall dort, wo Menschen für das, was sie tun, Geld erhalten und keine Alternative zu diesem Tun sehen, wenn sie weiter Geld erhalten wollen, droht diese kleine bis große menschliche Tragödie der gegenseitigen Benutzung und Instrumentalisierung. Sie muss nicht eintreten, aber ihr Eintreten wird umso wahrscheinlicher, je mehr Menschen, ob faktisch oder gefühlt, in einer beruflichen Tätigkeit feststecken, die sie nicht etwa als selbst gewählt, sondern als durch Marktzwänge auferlegt empfinden.
Fromm schlug deshalb, als einen Teil der Lösung, ein zeitlich befristetes (!) Grundeinkommen vor. Aber zu einer genauen Diskussion von Lösungsvorschlägen, zu den ‚Wegen aus einer kranken Gesellschaft‘, kommen wir in Teil 2. Jetzt ist es Zeit für eine kleine Zusammenfassung:
-
Ganz gleich, wieviel Grips es erfordern mag, sich mit Komplexität auseinanderzusetzen – wir sollten nie übersehen, dass sie Menschen Angst macht. Und wer in Angst ist, dem fällt die nüchterne Überlegung schwer – siehe ‚Brexit‘.
-
Leider finden wir in unserer Gesellschaft – sowohl im Staats- und Bilungswesen, als auch in der Arbeitswelt – nur wenige Organisationen vor, die dieser Angst vor Komplexität entschieden entgegen wirken könnten. Im Gegenteil: Verantwortung für unüberschaubare und vielfach verzweigte Probleme wird viel zu schnell und zu oft auf einzelne abgeschoben, die im Falle ihres Scheiterns zu viel Häme und zu wenig Verständnis erhalten. (Siehe auch #Fehlerkultur)
-
Erich Fromm regt deshalb einen Werte- und Kulturwandel in unseren sozialen Systemen an. Liebe und Solidarität sind dabei die wichtigsten Stichworte.
„Liebe – geht’s nicht eine Nummer kleiner?“ mögen jetzt die nüchterneren unter den LeserInnen fragen. Sicher: Über Begriffe lässt sich trefflich streiten. Weniger, meine ich, allerdings darüber, dass unsere Organisationen einen grundlegenden Wandel brauchen, eine Art psychischer (R)evolution. Das soll im zweiten Teil deutlicher werden – hier nur soviel:
Der Arbeitstitel dieses Artikels lautete: „Komplexität essen Seele auf“ – in Anlehnung an Rainer Werner Fassbinders bekannten Film Angst essen Seele auf. Dort wird gezeigt, wie die eigentlich guten Integrationschancen des ‚Gastarbeiters‘ Ali, der nicht nur einen Job, sondern auch eine Frau in Deutschland findet, durch das allgemeine Misstrauen und die Feindseligkeit seiner Umgebung zunichte gemacht werden. Die Angst vor den anderen, vor Isolation und Demütigung frisst bildlich seine Seele und ein Geschwür buchstäblich seinen Magen auf. Eine von vielen Krankheiten nur, die sich Menschen zuziehen können, wenn sie sich in einem Umfeld bewegen müssen, das alles von ihnen fordert und ihnen doch nichts schenkt.
Und dass hier weder ‚Gewinnermentalität‘ noch ‚Gesundheitsmanagement‘ weiterhelfen, wissen aufmerksame LeserInnen dieses Blogs schon seit der letzten Serie über Resonanz. Nein, es braucht mehr – und die Ausrede, das passe gerade nicht ins Geschäftsmodell oder in den persönlichen Karriereplan, ist eine ziemlich einfältige und vor allem sehr kurzsichtige. Sondern es ist an der Zeit, grundlegend etwas zu verändern. Und die Zeiten, sie sind günstig für solche Veränderungen. Dazu aber mehr in Teil 2, ab 15. Juli, an dieser Stelle.
Auch mal richtig tief ins Buch schauen? Für diesen Artikel gelesen:
Fromm, Erich: Wege aus einer kranken Gesellschaft, in: Erich Fromm: Gesamtausgabe, Band 4, Deutsche Verlagsanstalt, Stuttgart 1999 (Einzelausgaben des hier besprochenen Werks sind im Buchhandel und in Bibliotheken erhältlich.)
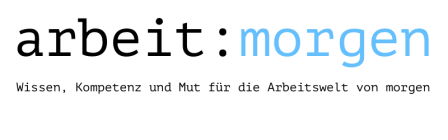
Ich war ja schon von den „Rosa-Resonanz-Beiträgen“ sehr angetan, durch die ich recht zufällig auf diesen Blog gestoßen bin. Und auch diesen Beitrag habe ich mit großer Zustimmung gelesen: Komplexität ist voraussetzungsvoll und diese Voraussetzungen sind ungleich verteilt. Nur mit Häme und Abwertung auf diejenigen zu reagieren, die da „nicht mitkommen“ ist kontraproduktiv und albern elitär. Und ich denke, es geht auch um die Frage, wo sind Erfahrungen von Gemeinschaft, Bindung und vor allem von Selbstwirksamkeit möglich? Vielen Dank für diese anregende Lektüre!
LikeLike
Vielen Dank für den Kommentar! Da stimme ich Ihnen zu – Der Umgang mit Komplexität ist auch auf der kommunikativen Ebene eine gewaltige Herausforderung, an der insbesondere unsere politische Öffentlichkeit derzeit allzuoft scheitert. Zu dem Thema habe ich übrigens an anderer Stelle gemeinsam mit einem Kollegen etwas geschrieben:
http://katapult-magazin.de/de/artikel/artikel/fulltext/emotionen-erlaubt/
Herzliche Grüße, Andreas Schiel
LikeLike
Ich habe das mit großem Interesse und weitgehender Zustimmung gelesen. Ich teile Ihre Beschreibung der Situation und die Forderung, dass sich die öffentliche Kommunikation ändern sollte/müsste. Im Moment fehlt mir allerdings noch die Phantasie, wie das konkret aussehen und funktionieren könnte. Wie könnte die Position derjenigen, die verbittert oder wütend sind angesichts von sich nicht realisierenden Lebenschancen, gewürdigt, bzw. auf eine konstruktive Weise in den kommunikativen Prozess eingebracht werden? Und, wenn Sie mir einen zweiten Einwand nachsehen, müsste nicht „eigentlich“ vorrangig das Entstehen solch massiver Verbitterung und Unzufriedenheit verhindert werden, weil sie – wenn sie denn erstmal da ist – kommunikative Prozesse nahezu unmöglich macht?
LikeLike
Natürlich wäre es schön, wenn man Zustände wie Unzufriedenheit und Verbitterung gewissermaßen präventiv vermeiden könnte. Und vielleicht ist ja zumindest der letztgenannte Gemütszustand (den übrigens der Existenzphilosoph Søren Kierkegaard ziemlich eindrücklich als ‚Verzweiflung‘ in ihren unterschiedlichen Erscheinungsformen beschrieben hat) tatsächlich vermeidbar – wenn man sich z.B. an Erich Fromm orientiert und versucht, im sozialen Miteinander mehr Solidarität und Liebe zu verwirklichen. Mal sehen, was in Teil 2 dazu stehen wird…
Allerdings ist ein einfacher ‚Tipp‘ in der Zwischenzeit, überall dort, wo sich handfeste und hartnäckige Unzufriedenheit bemerkbar macht, als Kommunikationsteilnehmer auf Augenhöhe zur Verfügung zu stehen. Das gilt für die AdressatInnen solcher Unzufriedenheit in allen Kontexten, also gleichermaßen für PolitikerInnen und andere Repräsentanten öffentlicher Institutionen wie für Führungskräfte in Unternehmen. Wenn man hier wie dort den Fehler macht, wiederholte Unmutsäußerungen pauschal als Illoyalität statt als Chance zur Überwindung der Unzufriedenheit – und damit zur produktiven Veränderung! – zu begreifen, dann werden aus Unzufriedenen schnell Verbitterte. Die sind dann in der Tat nur noch sehr schwer zu erreichen.
LikeLike
Ich bin gespannt auf den den zweiten Teil und werde mich von diesen Gedanken begleiten lassen, die mir spontan im Bereich der Arbeit zumindest etwas leichter realisierbar erscheinen, als im Politischen. Aber vielleicht fehlt mir da tatsächlich im Moment auch nur ein bisschen die Phantasie …
LikeLike
Pingback: It’s the psychology, stupid! – demokratiEvolution·